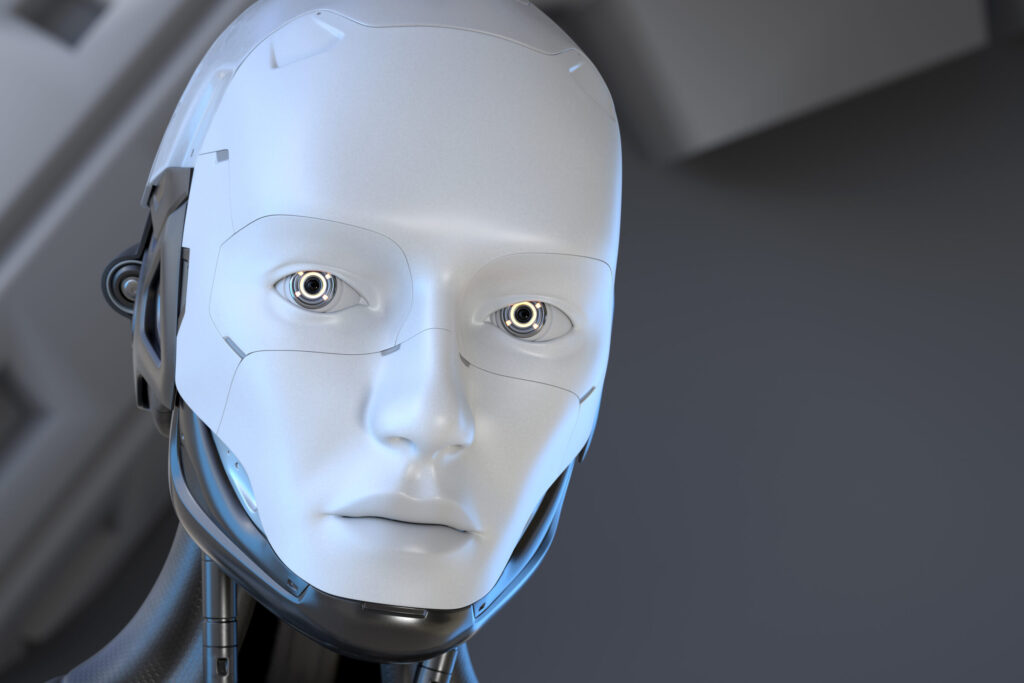Das Ersatzkindsyndrom 2025: Ein Schlüsselthema in Beratung und Therapie
Ich lebe anstelle eines anderen. Das ist das Ersatzkindsyndrom in einem Satz.
Worte, die erahnen lassen, wie vielschichtig und nachhaltig die Biografie und das Selbsterleben der hiervon betroffenen Menschen beeinflusst sein wird. Geboren nach dem Tod eines Geschwisters, tragen sie das unsichtbare Gewicht der Trauer und unerfüllten Hoffnungen der Eltern. In der Praxis erscheinen sie mit Depressionen, somatischen Störungen, Selbstwert- oder Bindungsproblemen. Es werden Persönlichkeitsstörungen vermutet, Suchtproblematiken, Ess- oder Zwangsstörungen.
Doch bei Ersatzkindern steckt hinter all den Symptomen eine verborgene Logik: das Leben im Schatten eines Toten.
Hinweis: Diese Symptome können auch andere Ursachen haben – bitte keine Selbst-Diagnose, sondern fachliche Abklärung suchen.
Das Ersatzkindsyndrom ist nicht so selten, wie es scheint
Vielmehr handelt es sich um ein verbreitetes, doch eher unbekanntes, oft abgewehrtes und somit übersehenes Phänomen. Die Ursache für seine Entstehung liegt in dem unbetrauerten oder nicht abschließend betrauerten Verlust eines Kindes. Der Schmerz wird von den Eltern nicht durchgearbeitet, sondern von einem – zumeist nachgeborenen – Geschwisterkind stellvertretend getragen.
Doch Ersatzkinddynamiken entstehen auch in anderen Konstellationen, etwa wenn ein Kind den Platz eines nicht geborenen, schwer erkrankten oder auch während seiner Lebenszeit verstorbenen Kindes einnimmt, in dem Versuch, Hoffnungen, Träume und Erwartungen der Eltern, die mit jenem Kind verbunden waren, zu erfüllen.
Seit der Aufnahme der Prolonged Grief Disorder in ICD‑11 und DSM‑5‑TR sind Trauerverläufe mit erheblicher Funktionsbeeinträchtigung klar definiert. Für nachgeborene Geschwister bedeutet das: Trauerstörungen der Eltern sind heute besser erkenn‑ und behandelbar. Wer Ersatzkind‑Dynamiken versteht, betrachtet nicht nur die Trauer der Eltern, sondern hat auch die Geschwister des verstorbenen Kindes im Blick und unterbricht die transgenerationale Weitergabe von Leid.
2025 – Die Familienstruktur verändert sich
Während die Anzahl der Totgeburten steigt, sinkt die Geburtenrate kontinuierlich und befand sich im Jahr 2023 auf dem niedrigsten Stand seit 2013. Zugleich steigt das Alter bei der ersten Geburt in den 30er‑Bereich, wodurch das Zeitfenster, um ein weiteres Kind zur Welt zu bringen, geringer wird.
Durch die verstärkte Nutzung der Reproduktionsmedizin nimmt die Zahl früher, oft unsichtbarer Verluste pro erfolgreicher Geburt zu. Kristina E. Schellinski sieht auch im Zusammenhang mit In-Vitro-Fertilisationen Anlässe, die zu unbewussten inneren Bildern eines Doppelgängers oder eines toten Anderen führen können (2020, S. 22). Dies legt einen möglichen Zusammenhang nahe; empirische Studien stehen noch aus.
Gleichzeitig lockern sich Familienverbände, der Rückgang des emotionalen Zusammenhalts ist weltweit belegt. Das macht im Krisenfall die Unterstützung durch externe Berater:innen und Therapeut:innen notwendig.
Doch die Wartezeiten bis zum Therapiebeginn sind vielerorts lang. Das erhöht das Risiko, dass aus einer übersehenden Familien‑Trauerlage chronische Störungen werden – bei Eltern und Geschwistern wie bei nachgeborenen Kindern. Wissen um das Ersatzkindsyndrom kann hier bereits zu besonderer Achtsamkeit gegenüber den trauernden Eltern und Geschwistern führen. Gleichzeitig kann bereits Psychoedukation gegenüber Ersatzkindern in einem ersten Schritt entlastend wirken.
Seit der Erstbeschreibung durch Cain & Cain (1964) ist bekannt, dass Kinder, die nach dem [Anmerkung der Autorin: nicht ausreichend betrauerten] Tod eines Geschwisters geboren werden, unbewusst Projektionen von Trauer, Schuld und Hoffnung tragen. Forschung und Praxis zeigen, wie tiefgreifend diese Dynamik Bindung und Entwicklung prägt:
“These children’s identity problems were such [that] they could barely breathe as individuals with their own characteristics and identity.” [„Diese Kinder hatten so gravierende Identitätsprobleme, dass sie kaum als eigene Persönlichkeiten atmen konnten.“] (Cain & Cain, 1964, S. 451)
Durch Aufklärung kann präventiv viel zur Vorbeugung von Ersatzkind-Dynamiken geleistet werden. Im Hinblick zur Wirksamkeit von Psychoedukation auf Betroffene vom Ersatzkind-Syndrom fehlen nach meinen Recherchen zurzeit noch empirische Studien. Hier empfiehlt es sich, weiter zu forschen.

Das Ersatzkindsyndrom: Verborgenes Leid
Worum handelt es sich hier? In erster Linie beschreibt das Ersatzkindsyndrom die Situation eines Kindes, das nach dem Verlust eines Geschwisters geboren wird und unbewusst dessen Platz einnimmt.
„A replacement child is a living child who comes to take the place of a dead one“, formulierte es der jungianische Analytiker Henry Abramovic. [„Ein Ersatzkind ist ein lebendes Kind, das an die Stelle eines toten Kindes tritt.“] (Abramovic, 2014, S.3 zit. nach Schellinski, 2020, S. 21)
Von Beginn an lastet die unsichtbare Erwartung auf ihm, den verlorenen Bruder oder die verlorene Schwester zu ersetzen. Es wird zum Träger der nicht gelebten Hoffnungen, der Trauer und der Schuldgefühle der Eltern. Und nicht zuletzt eine permanente Erinnerung an das Verlorene.
“The parents’ relationship with the new, substitute child [was] virtually smothered by the image of the lost child.” [„Die Beziehung der Eltern zu dem neuen Ersatzkind wurde praktisch vom Bild des verlorenen Kindes erstickt.“] (Cain & Cain, 1964, S. 453)
Diese Konstellation hat nachhaltige Auswirkungen auf die Entwicklung einer eigenen Identität:
“The development of identity is restricted by the fact that the child is constantly compared with the idealised dead sibling and asked to correspond to its unrealistic image.” [„Die Identitätsentwicklung wird eingeschränkt, weil das Kind fortwährend mit dem idealisierten toten Geschwister verglichen und aufgefordert wird, dessen unrealistischem Bild zu entsprechen.“] (Hirsch, 1997/2023, S. 1)
Unter diesen Umständen wird die Identität von Anfang an von einer fremden Zuschreibung überlagert. Für die Betroffenen bedeutet das: ein ständiger Kampf zwischen dem Versuch, den Erwartungen gerecht zu werden, und dem Drang, eine eigene Identität zu entwickeln. Genau hier liegt der Kern: Eine Identität im Schatten eines Toten oder Abwesenden kann nicht frei wachsen.
2025 – Die Rolle von Social Media
„Their parents compelled them to be like their dead siblings, to be identical with them, yet made it clear that they would never be accepted as „the same,“ and could never really be as good.“ [„Ihre Eltern zwangen sie, wie ihre toten Geschwister zu sein, mit ihnen identisch zu sein, machten ihnen aber klar, dass sie niemals als „gleich“ akzeptiert werden würden und niemals wirklich so gut sein könnten.“] (Cain & Cain, 1964, S. 451)
Die von Cain und Cain beobachtete Dynamik in trauernden Familien wurde in einer Zeit beschrieben, in der soziale Medien noch nicht existierten. Ich selbst habe als Ersatzkind die Erfahrung gemacht, dass bereits ohne mediale Dauerpräsenz die Erinnerung an meinen verstorbenen Bruder explizit und an meine verstorbene Schwester implizit in unserem Familienleben mitschwang.
Die Erinnerungskultur verändert sich. In seinem Essay „My Brother Died. His Facebook Page Lives On. The strange beauty of grieving on the internet“ aus dem Jahr 2024 beschreibt Charley Burlock eindrucksvoll, wie sich die über den Tod andauernde Präsenz seines Bruders auf Facebook für ihn anfühlt.
Social‑Media‑Erinnerungen, algorithmische Jahrestage und erste KI‑Avatare Verstorbener können tröstlich sein. Sie erhöhen aber auch das Risiko permanenter Vergleiche zwischen den lebenden und den verstorbenen Geschwistern.
Studien zeigen, dass Social-Media-Nutzung, wenn sie stark vergleichs- oder performance-orientiert ist, mit mehr Stimmungstiefs, Identitätsstress und dem Gefühl, nicht zu wissen, wer man ist, zusammenhängt. Für Ersatzkinder, die sich sowieso am toten Geschwister messen, wird die Frage „Darf ich überhaupt da sein?“ dadurch noch verstärkt.
Schon jetzt haben viele Jugendliche einen brüchigen Selbstwert, Schwierigkeiten in Beziehungen und das Gefühl, gar nicht richtig gemeint zu sein. Langzeitstudien zeigen: Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen liegt 2024/25 noch immer unter dem Niveau von vor 2020. Auf diesen bereits erhöhten Grundstress trifft bei Ersatzkindern der ständige Vergleich mit dem idealisierten Toten – Schuldgefühle und Selbstwertprobleme werden dadurch noch stärker.
Für Berater und Therapeutinnen ist es wichtig, einen Ersatzkind-Hintergrund mitzudenken, wenn Symptome und Symptomverlauf nicht in das gewohnte Erklärungsmuster passen.
Individuelles Überleben und gesellschaftliche Muster
[Triggerwarnung für den verlinkten Blogtext: Selbstverletzung, Tod eines Kindes, Suizid] „Wenn dein Bruder nicht gestorben wäre, gäbe es dich nicht.“ Die eigene Existenz baut darauf auf, dass ein anderer Mensch gegangen ist. Genau jener Mensch, mit dem sich das Ersatzkind niemals messen können wird. Und gegen das es, trotz seiner physischen Abwesenheit, niemals gewinnen kann. Ein Schattenboxen, das mit Schuldgefühlen, Selbstwertunsicherheit und einer tiefen Frage nach der eigenen Daseinsberechtigung einhergeht.
“The parents’ unresolved grief is folded into the psyche of a replacement child, who, as a consequence, may suffer a sense of emptiness and confusion.” [„Die unverarbeitete Trauer der Eltern lagert sich in die Psyche des Ersatzkindes ein, das infolgedessen unter Leere- und Verwirrtheitsgefühlen leiden kann.“] (Abramovitch, 2014, S. 52, zit. in Schellinski, 2020, S. 4)
So tragen die Betroffenen die unausgesprochenen Projektionen von Trauer, Schuld und Hoffnung der Eltern. Das hat existentielle Bedeutung: Autonomie und Individuation, unter Umständen auch Freude und Lebendigkeit bekamen in meinem Erleben die Qualität eines Verrats an der Familie.
“Some replacement children adapt to be a perfect child in a desperate effort to be loved, others react hyper‑sensitively to the expectations of others; their attempt at self‑validation may take the form of a rebellion against any expectation that they should adapt.“ [„Einige Ersatzkinder passen sich verzweifelt an, um das perfekte Kind zu sein und geliebt zu werden, andere reagieren überempfindlich auf Erwartungen; ihr Versuch der Selbstbestätigung kann in einer Rebellion gegen jede Erwartung münden, sich anzupassen.“] (Schellinski, 2020, S. 86)
Es stellt sich die Frage, inwiefern diese inneren Welten eine Resonanz in gesellschaftlichen Strömungen finden oder diese bedingen. Forschung in diesem Feld dürfte gerade in diesen Tagen hochrelevant sein.
Loyalität zur Ursprungsfamilie im therapeutischen Kontext
Diese Dynamiken bleiben jedoch auch im therapeutischen Kontext meist unbenannt. Sie tauchen in öffentlichen Diskursen kaum auf und zusätzlich haben Ersatzkinder meist früh gelernt, unter allen Umständen den Anschein von Normalität aufrechtzuerhalten. Vor Dritten ohnehin, und oft auch vor sich selbst.
Woher sollten sie wissen, dass sie die nicht in Worte gefassten Bilder der Eltern sowie das eigene Gefühl des Scheiterns angesichts einer unlösbaren Aufgabe tragen?
“Working with such analysands presents the risk that they unconsciously adapt to the analyst’s expectations just as they have learnt to do with parents, caretakers or siblings“ [„Die Arbeit mit solchen Analysanden birgt die Gefahr, dass sie sich unbewusst an die Erwartungen des Analytikers anpassen, so wie sie es bei Eltern, Betreuern oder Geschwistern gelernt haben.“] (Schellinski, 2020, S. 85)
Das deckt sich mit meinen eigenen Erfahrungen. Als Klientin war ich mir selbst dessen seinerzeit nicht im Ansatz bewusst. Ich äußere die persönliche Vermutung, dass es in Online-Therapie-Sitzungen noch leichter ist, den gewünschten Anschein zu geben als in räumlicher Präsenz. Auch durch die Möglichkeit, sich im eigenen Video-Spiegel permanent zu korrigieren. Was dies zukünftig für die Anwendung von KI-Formaten als Therapie-Ersatz bedeuten wird, lässt sich nur erahnen.
In der Praxis bedeutet das: Die Symptome werden behandelt, ohne dass die eigentliche Ursache erkannt wird. Eine rein symptomatische Behandlung birgt jedoch die Gefahr, die Dynamiken der Ursprungsfamilie zu wiederholen, anstatt neue emotionale Erfahrungen zu ermöglichen. Die Symptome werden dadurch eher zementiert, denn gemildert. Genau deshalb ist es so wichtig, die verborgene Logik dieser Biografien wahrzunehmen und in die professionelle Arbeit einzubeziehen.
Wenn Ersatzkinddynamiken im professionellen Kontext nicht erkannt werden, entstehen gravierende Risiken: Fehldiagnosen, stagnierende oder sogar retraumatisierende Therapieversuche, der oder die Betroffene bleibt im „Leben für den Anderen“ gefangen, Hoffnungslosigkeit, Somatisierungen.
2025 – Das Wissen ist verfügbar
“Held by an understanding other person who can mirror its development, an adult replacement child can reconstruct its identity.“ [In der Obhut einer verständnisvollen anderen Person, die seine Entwicklung widerspiegeln kann, kann ein erwachsenes Ersatzkind seine Identität rekonstruieren.](Schellinski, 2020, S. 15).
Ich selbst hatte nach zwei Jahrzehnten, in denen ich verschiedenste Therapieformen, inklusive einer mehr als vierjährigen klassischen Psychoanalyse nach Freud durchlaufen hatte, fast die Hoffnung aufgegeben. Doch es hatte sich gelohnt, nach dem Ursprung zu forschen.
Heute, nachdem ich den Urschmerz gesehen und ansatzweise gespürt habe, sehe ich auch den Sinn der vorherigen Interventionen. Sie hatten jedoch nicht greifen können, so lange meine Identität noch mit der meiner verstorbenen Geschwister verwoben war.
Ich würde es heute vielleicht so formulieren: Die Loyalität zu den Toten in mir und in meinem Familiensystem blockierte jeden therapeutischen Ansatz, der ins Leben hineinwies.
Es geht darum, dem Ersatzkind dabei zu helfen, sich von den Repräsentationen des verstorbenen, abwesenden und doch innerlich anwesenden toten Anderen zu ent-identifizieren, so Schellinski. Ich kann bestätigen, dass dies möglich ist. In teilweise schmerzhaften und mit Tabus aufgeladenen inneren Bewegungen, an deren Ende eine ganz neue Lebensqualität wartet.
Doch das gelingt nur, wenn Fachkräfte die Dynamik erkennen und einen geschützten Raum eröffnen, in dem Betroffene sich als eigenständige Personen erleben und sich im Vertrauen an das Unaussprechliche wagen dürfen.

Warum ist das Thema gerade in diesen Zeiten besonders relevant?
“Replacement children are still conceived today, born or designated after a loss of life due to accidents, diseases, war and violence, catastrophes, epidemics and famine.” „Auch heute noch werden Ersatzkinder gezeugt, geboren oder bestimmt, nachdem sie durch Unfälle, Krankheiten, Krieg und Gewalt, Katastrophen, Epidemien und Hungersnöte ihr Leben verloren haben.“ (Schellinski, 2020, S. 2)
Das zeigt: Die Dynamik ist kein historisches Relikt, sondern eine bis in die Gegenwart reichende Realität. Betrachtet man das Sterben in Europa angesichts zweier Weltkriege und der Massenvernichtung von rund zwölf Millionen Menschen im Holocaust wird das Ersatzkindsyndrom zu einer kollektiven Erfahrung.
Das rückt das Thema aus der historischen Distanz in die unmittelbare Gegenwart: Ersatzkind-Dynamiken, sind kein Relikt aus der Vergangenheit, sondern eine lebendige Realität, die sich in aktuellen Krisen erneut entfaltet.
Aus individueller Verletzlichkeit wird gesellschaftliche Verwundbarkeit. Kollektive Krisen und Traumata prägen Generationen. Sie beeinflussen soziale Entwicklungen, die wiederum auf die Psyche der Beteiligten zurückwirken. Das Verständnis der Ersatzkinddynamik könnte damit einen Schlüssel liefern, um individuelle Biografien mit gesellschaftlichen Brüchen zu verknüpfen.
Hier bietet sich ein breites und relevantes Forschungsfeld.
2025 – Ersatzkind-Dynamiken gewinnen an Bedeutung
In Zukunft wird die Bedeutung dieser Dynamik weiter steigen. Je stärker unsere Gesellschaft von Unsicherheit und Krisen geprägt ist, desto wichtiger wird es, die verborgenen biografischen Muster zu erkennen. Wer heute beginnt, diese Zusammenhänge in die Arbeit einzubeziehen, legt den Grundstein für eine sensiblere und nachhaltigere Praxis. Das Wissen um das Ersatzkindsyndrom ist damit nicht nur ein biografisches Detail, sondern ein Schlüssel zum tieferen Verständnis menschlicher Entwicklung und Heilung.
Ich habe meine Erfahrungen unter anderem im VFP-Podcast Psycho!logisch unter dem Titel #037 „Leben lernen im Schatten eines Toten“ geteilt. Dieses Gespräch, diese Internetpräsenz sowie weitere Veröffentlichungen sind Teil meines Beitrags, das Thema in Fachkreise einzubringen.
In diesem Artikel verwendete Literatur
Anisfeld L, Richards AD. The replacement child. Variations on a theme in history and psychoanalysis. Psychoanal Study Child. 2000;55:301-18. PMID: 11338994.
Avci H, Baams L, Kretschmer T. A Systematic Review of Social Media Use and Adolescent Identity Development. Adolesc Res Rev. 2025;10(2):219-236. doi: 10.1007/s40894-024-00251-1. Epub 2024 Nov 21. PMID: 40385471; PMCID: PMC12084248.
Cain, A. C., & Cain, B. S. (1964). On replacing a child. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 3(3), 443–456.
Hirsch, M. (2023). Psychodynamics and the fateful identity of the replacement child (A. Author, Trans.; original work published 1997). Unpublished manuscript.
Kaman A, Erhart M, Devine J, Napp AK, Reiß F, Behn S, Ravens-Sieberer U. Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Zeiten globaler Krisen: Ergebnisse der COPSY-Längsschnittstudie von 2020 bis 2024 [Mental health of children and adolescents in times of global crises: findings from the longitudinal COPSY study from 2020 to 2024]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2025 Jun;68(6):670-680. German. doi: 10.1007/s00103-025-04045-1. Epub 2025 Apr 28. PMID: 40293489; PMCID: PMC12129870.
Roman, N. V., Balogun, T. V., Butler-Kruger, L., Danga, S. D., Therese de Lange, J., Human-Hendricks, A., Thelma Khaile, F., October, K. R., & Olabiyi, O. J. (2025). Strengthening Family Bonds: A Systematic Review of Factors and Interventions That Enhance Family Cohesion. Social Sciences, 14(6), 371. https://doi.org/10.3390/socsci14060371
Schellinski, K. E. (2020). Individuation for adult replacement children: Ways of coming into being. Routledge.
Deutsche Übersetzungen: Frances Dahlenburg